Die Emotionsstrategie für Demokraten: Mit Gefühlen gegen Populismus
AfD und CDU gleichauf - und jetzt? Eine Analyse und eine Antwort.
Hallo und herzlich Willkommen zur neuen Adé AfD Folge,
die AfD liegt seit Samstag laut einer bundesweiten Umfrage mit der CDU gleichauf. Wir gucken uns heute an: Was hat es damit auf sich? Und: Was können wir tun?
In der Tat ist es auch laut Parteiforscher_innen ungewöhnlich, dass die führende Regierungspartei gleich zu Anfang so einen deutlichen Zustimmungsverlust erleidet. Parteienforscher Uwe Jun meint dazu:
“Normalerweise tritt das etwas später ein. Wir erleben immer, dass Regierungen nach einer gewissen Zeit an Unterstützung und Popularität verlieren - übrigens nicht nur in Deutschland, sondern europaweit. Aber der Zeitpunkt ist überraschend, dass eben die Unterstützung einer potenziellen Regierung zurückgeht, zumal die noch nicht einmal steht. Die Unzufriedenheit mit Politik ist allgemein stärker geworden. Radikalere Parteien befeuern das noch, indem sie dieser Unzufriedenheit noch viel stärker Ausdruck verleihen und bei vielen Wählerinnen und Wählern Gehör finden.” (Quelle: tagesschau.de)
Und wer profitiert am meisten von dieser Unzufriedenheit? Die AfD, weil sie möglichen Protest und vor allem diese Unzufriedenheit kanalisieren kann.
Was wir dabei bedenken sollten:
1️⃣ Dies ist nur eine Umfrage; eine andere von Infratest Dimap sieht die AfD zwei Prozentpunkte zurückliegend. Weitere Infos zu Online-Umfragen und Insa bietet zum Beispiel dieser Volksverpetzer-Artikel.
2️⃣ Das Ergebnis sollten wir in der aktuellen Übergangssituation betrachten. Wir haben eine geschäftsführende Bundesregierung und noch keine Neue im Amt. Umfrageergebnisse sollten vorsichtig interpretiert werden, da noch nicht klar ist, wer wann (und wie) regieren wird.
Außerdem: Wer profitiert von der Aufmerksamkeit solcher Berichterstattung? Die AfD. Solche Umfragen und deren Verbreitung können also zur Normalisierung der AfD beitragen, weil hier der Eindruck entstehen kann, die Partei hätte eine Mehrheit in der Bevölkerung. Daher ist es wichtig, den Kontext zu betrachten, in dem solche Umfragen erscheinen (auch natürlich in diesem Newsletter).
3️⃣ Die CDU/CSU und Friedrich Merz haben ein Glaubwürdigkeitsproblem:
Im Wahlkampf sprach sich die Union gegen neue Schulden aus. Einen Tag nach der Wahl setzte sich Merz für ein neues Sondervermögen ein. Dieser Richtungswechsel bei Finanzen und Schuldenbremse ist kommunikativ problematisch.
Obwohl Merz behauptet, er habe vor der Wahl eine mögliche Reform signalisiert, gibt es zahlreiche Aussagen, in denen er dies ausschloss. Im CDU/CSU-Wahlprogramm steht, dass die Schuldenbremse unverändert bleiben soll. Jetzt wird Merz vorgeworfen, zentrale Wahlversprechen nicht umzusetzen (bzw. nicht umsetzen zu können).
Die CDU steckt in internen Konflikten und einer Glaubwürdigkeitskrise, wobei auch unklare Positionen in Koalitionsverhandlungen eine Rolle spielen. Diese Vorgehensweise stößt bei Wählerschaft, CDU-Mitgliedern und Teilen der Jungen Union auf Widerstand.
Mehr dazu findet ihr auch in diesem Artikel über Merz bei der ZEIT oder in diesem Spiegel-Artikel zur Jungen Union.
4️⃣ Die CDU/CSU und Friedrich Merz haben ein AfD-Strategie-Problem:
Die Wissenschaft ist sich einig, dass durch die Übernahme rechtspopulistischer Sprache, Narrative und Positionen werden rechtspopulistische Parteien gestärkt. Eine Annäherung an die AfD und ihre Themen hilft also vor allem der AfD.
Die CDU und Friedrich Merz haben im Wahlkampf auf eine Annäherung an AfD und ihre Themen gesetzt, bis hin zu der Bereitschaft, am 27.1.2025 AfD-Stimmen für eigene Anträge in Kauf zu nehmen. Am Wahlergebnis sieht man: Die Union hat bei der Bundestagswahl 2025 über 1 Million Stimmen an die AfD verloren. Bislang gibt es keine Einordnung aus der Partei, wie man damit umgehen will.
Fakt ist: Aussagen gegen eine Zusammenarbeit mit der AfD ersetzen weder eine strategische Vorgehensweise noch eine ehrliche Erklärung an Wähler:innen, wie man diese umsetzen wird.
Wie will man (nach dem 27. Januar) Abgrenzung tatsächlich definieren und umsetzen?
Welche Konsequenzen zieht man aus dem Wählerverlust nach einem Wahlkampf, der auf AfD-Themen setzte?
Mehr dazu findet ihr auch in diesem Newsletter, in dem ich die Brandmauer Debatte rund um die Abstimmung mit der AfD im Bundestag am 27. Januar nochmal eingeordnet habe.
Die große Frage bleibt aber natürlich: Was tun?
Augenscheinlich brauchen wir dringend neue, andere Antworten auf die Frage:
Wie erreicht man Wähler_innen für demokratische Themen? Und zwar, ohne selbst zu Populisten zu werden?
Das habe ich Johannes Hillje gefragt. Johannes ist Politikberater und Autor des gerade erschienenen Buches “Mehr Emotionen wagen. Wie wir Angst, Hoffnung und Wut nicht dem Populismus überlassen.”
Er erklärt uns in dieser Folge, welche Rolle Emotionen in der Politik, der AfD und für alle demokratischen Politiker_innen spielen (sollten). Und wie wir vielleicht alle mit Emotionalisierung - auch und gerade im Politischen - demokratische Werte besser vermitteln können, ohne populistisch zu werden.
UND allerbeste News für den heutigen Montag: Ihr könnt dieses kluge Buch gewinnen. Einfach eine Mail an mich und ihr landet im Lostopf. Daumen sind gedrückt!
Und damit übergebe ich an Johannes:
Die AfD liegt gleichauf mit der CDU: Wie erklärt sich das?
Die Umfragewerte sind das Ergebnis der Umbruchszeit, in der wir uns gerade befinden: Die alte Bundesregierung ist nur noch geschäftsführend im Amt, während sich die neue erst noch bilden muss. Deswegen darf man die Umfrageergebnisse nicht überbewerten. Andererseits hängen sie natürlich auch mit Merz‘ strategischen und kommunikativen Fehlern zusammen.
Seinen Kurswechsel in der Finanzpolitik hätte er viel besser erklären müssen, immerhin ist ja eine Mehrheit der Unionsanhänger für die Investitionen. Stattdessen hat er aber nur "Ich-habe-es-doch-schon-immer-gesagt"-Botschaften gesendet. Der strategische Fehler: Entgegen allen wissenschaftlichen Erkenntnissen versuchte Friedrich Merz, die AfD durch Annäherung zu schwächen. Das war die pure Selbstüberschätzung.
Die AfD ist nach der letzten Bundestagswahl noch größer, noch stärker. Brauchen demokratische Parteien einen völlig neuen Umgang?
Bisher gab es im Umgang mit der AfD zwei Hauptstrategien: einerseits die Dämonisierung, also das starke Dagegen-Sein, wobei man viel über die AfD und wenig über die eigene Politik redet; andererseits die Normalisierung, also die Anpassung an deren Rhetorik und Positionen. Beides hat nicht zum Erfolg geführt und beides untergräbt das eigene Politikangebot.
Die Konsequenz müsste sein, dass man a) sein Politikangebot verbessert und b) es besser vermittelt. Und da kommt die Emotionalisierung ins Spiel.
Welche Rolle spielen Emotionen für und bei der AfD? Und wieso klappt das nicht mit der sogenannten Entzauberung durch Fakten?
Die AfD hat die Macht der Emotionen erkannt: Sie verstärkt Sorgen zu Ängsten, wandelt Ängste in Wut um und bietet gleichzeitig hoffnungsvolle Identifikation. Während der aggressive Populismus mit Wut mobilisiert, bindet er mit positiven Gefühlen wie Stolz und Gemeinschaft die Menschen langfristig.
Der Wahlkampf war für die AfD- Anhängerschaft auch von solchen positiven Emotionen geprägt. Veranstaltungen wie Volksfeste, Rechtsextremismus mit Feelgood-Charakter.
Die viel beschworene 'Entzauberung durch Fakten' scheitert, weil wir Menschen, das besagt auch die Forschung, 98 Prozent unserer Entscheidungen emotional und unbewusst treffen. Faktenchecks bleiben sachlich und erreichen oft nur wenige, während emotionalisierte Inhalte in sozialen Medien systematische Aufmerksamkeitsvorteile genießen.
Um Populismus wirksam zu begegnen, müssen wir Fakten nicht allein, sondern in Verbindung mit demokratischen Emotionalisierungen vermitteln. Anders gesagt: Wir müssen die Fakten emotionalisieren.
Warum tun wir uns in Deutschland mit Emotionen in der Politik so schwer?
Es gibt zwei maßgebliche Gründe für diese Kultur der Emotionsaversion:
Erstens: Nach dem Zweiten Weltkrieg hat man als Lehre aus dem Emotionsmissbrauch der Nazis einen besonders emotionslosen Politikstil entwickelt. Unser erster Bundespräsident, Theodor Heuss, prägte das sogenannte "Pathos der Nüchternheit". Auch Helmut Schmidt empfahl die "nüchterne Leidenschaft" - und Olaf Scholz attestierte sich beschönigend ein "Charisma des Realismus".
Zweitens folgen wir in Deutschland einem Verständnis von Aufklärung, das besagt, in einer aufgeklärten Gesellschaft müsse Emotionalität aus politischen Debatten herausgehalten werden. Dass Emotionalität und Rationalität Gegensätze seien – als wäre Emotion der natürliche Feind der Rationalität. Diesen behaupteten Gegensatz haben die Neurowissenschaften längst widerlegt, es gibt dieses Entweder-oder von Emotionen und von Rationalität nicht. Selbst Immanuel Kant erkannte das in seinen späten Schriften.
Ich glaube, wir alle müssen uns in Erinnerung rufen, dass der Aufstieg der Nazis auch dadurch begünstigt wurde, dass es nur ein schwach ausgeprägtes Emotionsangebot der Demokraten in der Weimarer Republik gab - im Gegensatz zu einer vereinnahmenden Emotionsmanipulation der Nationalsozialisten.
Meine Lehre wäre: Man darf die Emotionen nicht den Demokratiefeinden überlassen. Gerade jetzt, wo wir alle beobachten können, wie radikale Kräfte erneut die Emotionen bestimmen.
Wie schaffen wir es, Emotionen einzubinden, aber nicht populistisch zu werden?
Es wäre falsch, Emotionen und Populismus gleichzusetzen. Der Populismus arbeitet zwar mit Emotionen, aber Emotionen sind kein Alleinstellungsmerkmal des Populismus, sondern in erster Linie ein Charakteristikum des Menschen.
Die Neurowissenschaft sagt uns seit vielen Jahren, dass Emotionen eine wichtige Rolle bei Entscheidungen spielen. Es ist immer eine Teamarbeit aus Gefühlen und Vernunft, wenn wir uns entscheiden oder eine Einstellung ausbilden. Als Politiker oder Politikerin kann man Emotionen nicht ignorieren. Denn: Beim Menschen gehören Emotionen dazu. Wir können und dürfen sie also auch aus der Politik nicht wegdenken.
Was wir stattdessen tun müssen: Unterscheiden lernen zwischen populistischer Affektpolitik und demokratischer Emotionalisierung.
Was bedeutet das: Demokratische Emotionalisierung?
Demokratische Emotionalisierung heißt: Ich lade mein eigenes politisches Angebot emotional auf, ohne dabei demokratische Grundwerte wie Menschenwürde oder Pluralismus zu verletzen. Menschen werden zum Beispiel emotional, wenn durch Politik wichtige Werte verwirklicht oder verletzt werden.
Zum Beispiel im Bereich der Sicherheit und sozialen Gerechtigkeit. Menschen sind immer emotional, wenn Themen ihre eigene Lebenswelt betreffen. Deswegen emotionalisieren Diskussionen über Mobilität, Ernährung, Heizen oder Wohnen so stark.
Eine Regierung muss es zudem schaffen, ein positives Identifikationsangebot, mindestens aber Vertrauen und ein Kontrollgefühl zu schaffen, um die Menschen für Veränderung zu gewinnen.Ich plädiere also für eine demokratische Emotionskultur. Und zwar ohne, dass wir bzw. die Politiker_innen dabei die Grenze zur undemokratischen Emotionalisierung zu überschreiten.
Woran erkennen wir diese Grenze?
Undemokratische Emotionalisierung umfasst vier Formen:
Erstens Dehumanisierung: Ich spreche bestimmten Gruppen die Menschlichkeit ab.
Zweitens Antagonisierung: Ich erkläre politische Mitbewerber zu Feinden.
Drittens Wahrheitsmonopolisierung: Ich erhebe meine Position zur unumstößlichen Wahrheit, auch wenn ich offensichtlich lüge.
Und viertens Demokratieverachtung: Ich untergrabe die Legitimation demokratischer Institutionen.
Worauf sollten wir als Bürger_innen achten, um undemokratische Emotionalisierung zu erkennen?
Achten Sie darauf, ob die Menschenwürde eingeschränkt oder das Menschsein abgesprochen wird, wie wir es oft im Flüchtlingsdiskurs sehen. Beobachten Sie, wie über demokratische Institutionen geredet wird: Werden Gerichtsurteile akzeptiert oder nicht? Wie geht man mit legitimen anderen demokratischen Meinungen um? Wie lebt man den Wert der Meinungsfreiheit?
Bei undemokratischer Emotionalisierung wird am Ende oft ein demokratischer Grundwert verletzt – sei es Menschenwürde, Meinungsfreiheit, individuelle Freiheit, Rechtsstaatlichkeit, Solidarität oder Gleichberechtigung.
Wie können wir alle Demokratie emotionaler vermitteln?
Demokratie ist als abstraktes politisches System schwer greifbar. Aber wir alle profitieren in unserem Alltag davon: durch freie Berufswahl, freie Bildung und die Möglichkeit, mit größtmöglicher Freiheit zu sagen und zu tun, was wir möchten.
Ein konkretes Beispiel ist das Thema Abtreibung, wie wir es in Polen gesehen haben. Als dort das Recht auf Abtreibung eingeschränkt wurde, gingen viele Menschen auf die Straße, weil sie merkten, was die Beschneidung demokratischer Grundrechte für ihr eigenes Leben bedeutet.
So kann man Demokratie auf das Erfahrbare und Fühlbare im Alltag herunterbrechen. Mit diesem Thema wurde die rechtspopulistische PiS-Regierung am Ende abgewählt.
Was kann jeder Einzelne tun, um zu einer demokratischen Emotionskultur beizutragen?
Zu einer demokratischen Emotionskultur gehört eine gesunde Streitkultur – also dass wir nicht vor Meinungsunterschieden zurückschrecken, sondern sie als natürlichen und erwünschten Bestandteil von Demokratie auffassen.
Die Ampel-Koalition war dafür kein gutes Vorbild, weil der Streit nicht zu besseren Lösungen geführt hat, aber ich hatte manchmal das Gefühl, dass die Bevölkerung überhaupt nicht bereit ist, Dissens und Streit in der Politik zu ertragen. Wir müssen alle streittoleranter werden, die Debatte als Chance zum gegenseitigen Lernen verstehen.
Man kann zum Beispiel in Unternehmen Debattentage einführen, in Schulen das Fach Rhetorik stärken oder auch Perspektivwechsel ermöglichen, indem man für einen Tag einen anderen Job ausprobiert. Das stärkt Empathie – also das Verstehen anderer Sichtweisen, eine sehr wichtige Emotion für demokratische und vielfältige Gesellschaften
Ich sage Danke an Johannes! Für alle, die sich weiter mit dem Thema Politik & Gefühle beschäftigen wollen, empfehle ich auch Prof. Dr. Maren Urners Buch “Radikal emotional. Wie Gefühle Politik machen”.
Und mich interessiert zum Abschluss:
Die meisten Fragen, die ihr mir schickt, drehen sich darum, wie wir im Job, als Unternehmen, als Führungskräfte mit dem Thema AfD, bzw. Haltung zeigen umgehen sollten/können/wollen.
Daher jetzt die Frage an alle (wenn euch hier etwas fehlt: Mailt mir einfach eure Frage!):
🙋🏼♀️ Franzi als Politik- und Kommunikationsberaterin buchen:
Zum Beispiel für:
Strategien zur Positionierung und im Umgang mit gesellschaftspolitischen Themen: Ich entwickle politische Kommunikation für Führungskräfte in Unternehmen, Verbänden, NGOs.
Workshops & Formate: Kommunikation, Demokratie am Arbeitsplatz, KI, Social Media-Strategie und Rhetorik (z.B. Umgang mit Populismus).
Kommunikation & KI: Einsatz in politischer Kommunikation, gegen Desinformation, Hatespeech & die AfD.
Keynotes, Vorträge und Panels zu Kommunikation, Demokratie, Populismus oder Künstlicher Intelligenz.
Mehr zu mir findet ihr hier.
📲 Folgt mir gerne auf Instagram oder LinkedIn.
📖 Mein Sachbuch “Anleitung zum Widerspruch” liefert klare Antworten auf Parolen, Vorurteile und Verschwörungstheorien. Das Buch erklärt dir, was du sagen kannst, wenn du schlicht nicht weiter weißt und dich sprachlos fühlst. Zum Beispiel: Was sage ich bei rassistischen Sprüchen, wie reagiere ich auf Antisemitismus und kann ich lernen besser zu streiten (Spoiler: Ja!)?




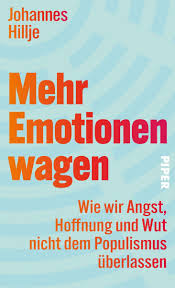
Liebe Franzi von Kempis,
vielen Dank für diesen starken Beitrag! Du bringst es auf den Punkt: Wer die Demokratie stärken will, muss endlich lernen, Emotionen nicht den Populisten zu überlassen. Fakten allein reichen nicht – es braucht Bilder, Geschichten und Gefühle, die im Gedächtnis bleiben. Deine Analyse ist nicht nur treffend, sondern auch motivierend für alle, die sich für eine lebendige, wehrhafte Demokratie einsetzen.
Ich beschäftige mich auf meinem Blog „Smart gedacht“ ebenfalls mit politischen Strategien und gesellschaftlichen Entwicklungen – immer mit dem Ziel, Zusammenhänge verständlich zu machen, ohne zu vereinfachen. Vielleicht hast du ja Lust, einmal vorbeizuschauen:
👉 https://smartgedacht.substack.com/
Herzliche Grüße und nochmals danke für deinen wichtigen Beitrag!
betrachtet man die 🚦Politik der letzten Jahre kann man durchaus feststellen, woher der Zustrom zur AfD kommt👌🏻